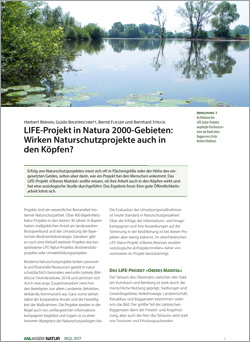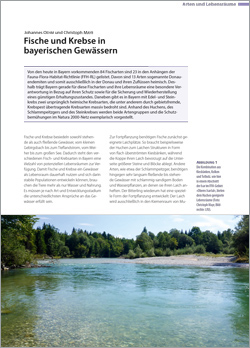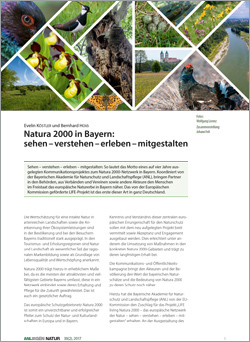Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse, Publikationen und Ereignisse aus Wissenschaft und Naturschutz. Die hier vorveröffentlichten Kurznachrichten werden zweimal jährlich in der Zeitschrift ANLiegen Natur zusammenfassend publiziert.
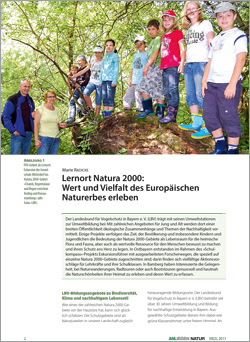
Titelseite des Artikels über den Lernort Natura 2000.
Marie Radicke
https://doi.org/10.63653/dsri0756
Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) trägt mit seinen Umweltstationen zur Umweltbildung bei: Mit zahlreichen Angeboten für Jung und Alt werden dort einer breiten Öffentlichkeit ökologische Zusammenhänge und Themen der Nachhaltigkeit vermittelt. Einige Projekte verfolgen das Ziel, der Bevölkerung und insbesondere Kindern und Jugendlichen die Bedeutung der Natura 2000-Gebiete als Lebensraum für die heimische Flora und Fauna, aber auch als wertvolle Ressource für den Menschen bewusst zu machen und ihren Schutz ans Herz zu legen. In Ostbayern entstanden im Rahmen des „Schulkompass „-Projekts Exkursionsführer mit ausgearbeiteten Forscherwegen, die speziell auf einzelne Natura 2000-Gebiete zugeschnitten sind; darin finden sich vielfältige Aktionsvorschläge für Lehrkräfte und ihre Schulklassen. In Bamberg haben Interessierte die Gelegenheit, bei Naturwanderungen, Radtouren oder auch Bootstouren genussvoll und hautnah die Naturschönheiten ihrer Heimat zu erleben und deren Wert zu erfassen.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 25. Oktober 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
51990 mal aufgerufen | 0

| 0


Titelseite des Artikels über Gebietsbetreuer und Natura 2000.
Hannes Krauss, Judith Kronberg, Michaela Schneller, Christian Salomon, Torsten Kirchner, Eckardt Kasch, Isolde Miller und Dirk Alfermann
https://doi.org/10.63653/inxm9416
Seit 2002 betreuen Gebietsbetreuer in Bayern ökologisch sensible Naturräume – ein Großteil davon sind Natura 2000-Gebiete. Als Ansprechpartner vor Ort kümmern sie sich um schützenswerte Natur- und Kulturlandschaften mit ihren einzigartigen Tier- und Pflanzengesellschaften. Ihr Auftrag ist so vielseitig wie anspruchsvoll. Sie verstehen sich zugleich als Anwälte der Natur sowie der dort lebenden Menschen und vermitteln zwischen deren jeweiligen Interessen. Als Ansprechpartner für alle beteiligten Akteure beraten sie Land- und Forstwirte, unterstützen Ämter und Planungsbüros, informieren interessierte Einheimische und Urlauber. Und nicht zuletzt begeistern sie durch Exkursionen und Outdoor-Aktionen Kinder und Jugendliche für die Schätze der Natur jenseits von Playstation und Smartphone.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 25. Oktober 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
51807 mal aufgerufen | 0

| 0


Titelseite des Artikels über die Wildlandstiftung Bayern.
Ulrike Kay-Blum
https://doi.org/10.63653/wwqh9627
Die Wildland-Stiftung Bayern setzt als Naturschutzstiftung des Bayerischen Jagdverbands seit ihrem nun 50-jährigen Bestehen zahlreiche Naturschutzprojekte in Bayern um. Viele der stiftungseigenen Flächen gehören heute zum europäischen Netz der Natura 2000-Gebiete zum Erhalt der Biodiversität, also der Vielfalt an Lebensräumen mit zum Teil hochbedrohten Tier- und Pflanzenarten. Schwerpunkte der Arbeit der Stiftung liegen im Schutz von Lebensräumen für Wiesenbrüter, dem Erhalt strukturreicher Kulturlandschaft mit Hecken, Streuobstbeständen, Ranken und Saumbiotopen, dem Schutz von Moorgebieten oder dem Erhalt naturnaher Bäche für den Schutz von Flora und Fauna im und am Gewässer. Zahlreiche Umweltbildungsveranstaltungen führen die Bevölkerung vor Ort an diese Naturschätze heran und sensibilisieren zum Verhalten in und mit der Natur.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 18. Oktober 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
48641 mal aufgerufen | 0

| 0


Titelseite des Artikels über den BUND Naturschutz und Natura 2000.
Christine Margraf
https://doi.org/10.63653/optr6303
Der BUND Naturschutz in Bayern e. V. (BN) engagiert sich auf allen Ebenen für Natura 2000. Dank der umfassenden Arten- und Biotopkenntnisse seiner ehrenamtlichen und professionellen Mitarbeiter war er maßgeblich an der Auswahl geeigneter Schutzgebiete beteiligt. Die fachliche Betreuung und praktische Projektarbeit wird durch engagierte Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung ergänzt. Gleichzeitig treibt der BN auf politischer Ebene die zügige und konsequente Umsetzung der Regelwerke voran und wacht über die konsequente Einhaltung der Schutzbestimmungen.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 18. Oktober 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
50892 mal aufgerufen | 0

| 0

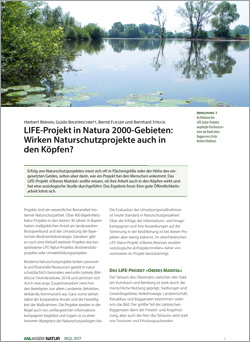
Titelseite des Artikels über die Wirkung von Naturschutzprojekten.
Herbert Rebhan, Guido Bauernschmitt, Bernd Flieger und Bernhard Struck
https://doi.org/10.63653/tplu3769
Erfolg von Naturschutzprojekten misst sich oft in Flächengröße oder der Höhe des eingesetzten Geldes, selten aber darin, wie ein Projekt bei den Menschen ankommt. Das LIFE-Projekt „Oberes Maintal“ wollte wissen, ob ihre Arbeit auch in den Köpfen wirkt und hat eine soziologische Studie durchgeführt. Das Ergebnis freut: Eine gute Öffentlichkeitsarbeit lohnt sich.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 12. Oktober 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
51788 mal aufgerufen | 0

| 0

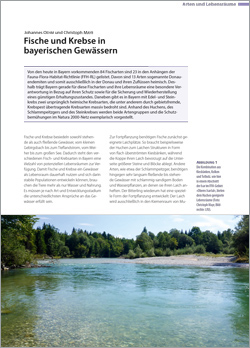
Titelseite des Artikels über Fische und Krebse in bayerischen Gewässern.
Johannes Oehm und Christoph Mayr
https://doi.org/10.63653/abww7411
Von den heute in Bayern vorkommenden 84 Fischarten sind 23 in den Anhängen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) gelistet. Davon sind 13 Arten sogenannte Donauendemiten und somit ausschließlich in der Donau und ihren Zuflüssen heimisch. Deshalb trägt Bayern gerade für diese Fischarten und ihre Lebensräume eine besondere Verantwortung in Bezug auf ihren Schutz sowie für die Sicherung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 04. Oktober 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
50543 mal aufgerufen | 0

| 0


Titelseite des Artikels über Muscheln und Schnecken.
Katharina Stöckl und Manfred Colling
https://doi.org/10.63653/sujs9535
Einige Arten aus dem Stamm der Weichtiere werden als europäisches Naturerbe über das Netzwerk von Natura 2000 geschützt, darunter auch sechs Schnecken- und zwei Muschelarten aus Bayern. Ihre geringen Aktionsradien und komplexen Lebenszyklen machen die Mollusken besonders anfällig für Beeinträchtigungen ihres Lebensraumes.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 04. Oktober 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
50553 mal aufgerufen | 0

| 0


Titelseite des Artikels „LIFE-Projekte in Bayern“.
Paul-Bastian Nagel
https://doi.org/10.63653/bqpg2587
In Bayern wurden und werden 25 LIFE Natur-Projekte umgesetzt, die dem Schutz der Lebensräume (Anhang I), der Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) sowie den Vogelarten des Anhanges I der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) dienen.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 28. September 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
49510 mal aufgerufen | 0

| 0

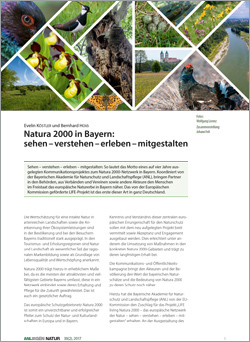
Titelseite des Artikels über das Life-Projekt „LIFE living Natura 2000“.
Evelin Köstler und Bernhard Hoiß
https://doi.org/10.63653/yysc9019
Sehen – verstehen – erleben – mitgestalten: So lautet das Motto eines auf vier Jahre ausgelegten Kommunikationsprojektes zum Natura 2000-Netzwerk in Bayern. Koordiniert von der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), bringen Partner in den Behörden, aus Verbänden und Vereinen sowie andere Akteure den Menschen im Freistaat das europäische Naturerbe in Bayern näher.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 28. September 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
50115 mal aufgerufen | 0

| 0


Titelseite des Artikels „Natura 2000 erhält Heimat“.
Nicolas Liebig
https://doi.org/10.63653/eamp7653
Vor 25 Jahren haben sich die EU-Mitgliedsstaaten mit der Verabschiedung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) dazu verpflichtet, die großartige Idee eines europaweiten Biotopverbundes unter dem Namen „Natura 2000“ in die Tat umzusetzen.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 20. September 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
51060 mal aufgerufen | 1

| 0

Weitere Artikel:
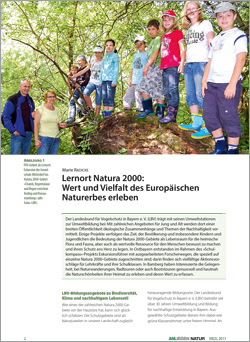
 | 0
| 0