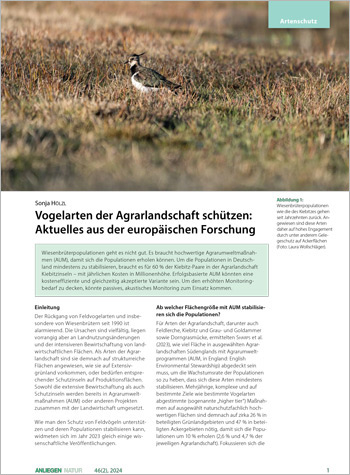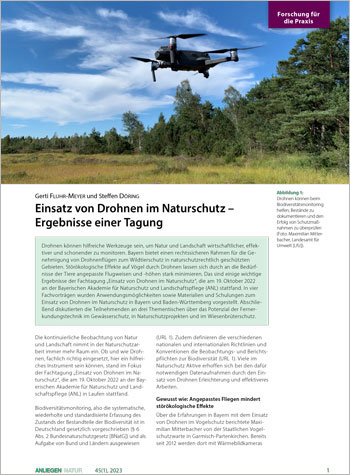Biodiversitätsförderung im Industriesektor – Indikatoren für das Umweltmanagement und Monitoring
Laura Barth, Matthias Dirr und Michael Rudner
https://doi.org/10.63653/vive1150
Die Bewertung der Biodiversität ist nach dem europäischen Gemeinschaftssystem für Umwelt-management und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) verpflichtend, wird bislang aber nur sehr grob abgebildet. Es wird ein Ansatz mit neuen Indikatoren vorgestellt, der mit begrenzten Ressourcen umsetzbar ist und ein fortlaufendes Monitoring erlaubt. Für die Darstellung im Umweltbericht werden drei Kennziffern abgeleitet. Über das Bewertungsergebnis können gezielt Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität auf dem Betriebsgelände entwickelt werden.
Summary
Biodiversity promotion in the industrial sector – environmental management and monitoring indicators
The assessment of biodiversity is mandatory under the European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), but has so far only been mapped very roughly. An approach with new indicators is presented that can be implemented with limited resources and allows continuous monitoring. Three indicators are derived for presentation in the environmental report. The assessment results can be used to develop targeted measures to promote biodiversity on the company premises.
Weiterlesen »

 | 0
| 0