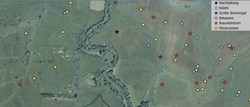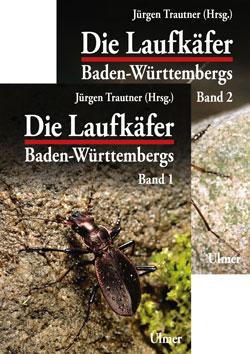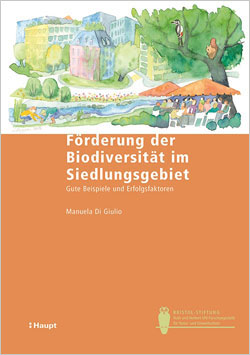Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse, Publikationen und Ereignisse aus Wissenschaft und Naturschutz. Die hier vorveröffentlichten Kurznachrichten werden zweimal jährlich in der Zeitschrift ANLiegen Natur zusammenfassend publiziert.

Titelbild des Buches „Insekten im Wald“.
(Bernhard Hoiß) Kürzlich erschien beim Haupt Verlag das Buch „Insekten im Wald“. Es zeigt die vielfältige Bedeutung von Insekten für Wald und Mensch. Das Buch ist in 18 Kapitel eingeteilt, die sich primär den verschiedenen Ökosystemfunktionen der Insekten im Wald beziehungsweise in assoziierten Lebensräumen widmen. Im Vordergrund stehen dabei die Prozesse und Netzwerke (beispielsweise Pflanzenvermehrung, Abbau von Holz, Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, Nahrungsnetzwerke). Eine Vielzahl von Beispielen mit hochwertigen Fotos zeigt, wie die einzelnen Teile des Ökosystems voneinander abhängen, miteinander interagieren und so ein funktionierender Wald entsteht. Auch der Gefährdung von Arten und den Ursachen wird ein Kapitel gewidmet.
Der Autor Beat Wermelinger ist Leiter der Forschungsgruppe Waldentomologie an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Die Beispiele im Buch sind auf Basis seines großen eigenen Bildfundus sowie seinen Forschungs- und Lehrtätigkeiten ausgewählt.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 01. Juni 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
51973 mal aufgerufen | 1

| 0

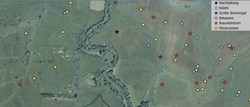
Beispiel für unterschiedliche Siedlungsdichten und Artenspektren in einem der Untersuchungsgebiete. Aufgrund der hohen Gehölzdichte westlich des Flusses können sich trotz vergleichbarer Qualität der Streuwiesenlebensräume nur wenige Wiesenbrüterarten in geringer Dichte ansiedeln (Foto: Ingo Weiß).
(Margarete Siering) Wiesenbrüter gehören zu den am stärksten gefährdeten Vogelgruppen in Bayern. Gehölzsukzession in Extensivwiesen oder im Rahmen der Landschaftspflege belassene Gehölze sind bedeutende Stör- und Gefährdungsfaktoren für die Wiesenbrüter. Sie schränken den Lebensraum ein und fördern Prädatoren. Um Empfehlungen zu Gehölzdichten in Wiesenbrütergebieten abgeben zu können, wurden Revierkartierungen von Wachtelkönig, Großem Brachvogel, Kiebitz, Bekassine, Braunkehlchen und Wiesenpieper aus den fünf bedeutendsten Wiesenbrütergebieten im oberbayerischen Voralpenland (Ampermoos, Ammersee-Süd, Loisach-Kochelsee-Moore, Murnauer Moos und Bergener Moos) durch das Bayerische Landesamt für Umwelt analysiert.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 24. Mai 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
53693 mal aufgerufen | 15

| 0


Durch verschiedene Mahdzeitpunkte werden kurzrasige und höher gewachsene Wiesenstrukturen mosaikartig im Königsauer Moos erhalten. Durch die Diversität des Wiesenschnitts werden Pflanzen, Insekten, Spinnen und Mollusken erhalten, die als Nahrung für die Wiesenbrüter dienen können (Foto: Norbert Maczey).
(Margarete Siering) Das Königsauer Moos (1.365 ha) im Unteren Isartal, Landkreis Dingolfing-Landau, stellt mit derzeit bis zu 66 Brutpaaren eines der wichtigsten Bruthabitate des Großen Brachvogels (Numenius arquata) in Bayern dar. In einem 722 ha großen Teilbereich des Königsauer Mooses finden jährlich Artenhilfsmaßnahmen für den Großen Brachvogel statt. In diesem Untersuchungsgebiet steigerte sich die Anzahl der Brutpaare in den letzten Jahren enorm (2000 bis 2009 durchschnittlich 27 Brutpaare, 2010 bis 2015 durchschnittlich 57 Brutpaare). Ein Top-Gebiet für den Großen Brachvogel wird neben der Anzahl der Brutpaare durch seinen Bruterfolg definiert.
Im Königsauer Moos variiert der Bruterfolg von Jahr zu Jahr recht stark (von 0 bis 1,4), so dass sich durchschnittlich in den Jahren 2005 bis 2015 ein jährlicher Bruterfolg von 0,56 flüggen Jungvögeln pro Brutpaar ergibt. Um den Bruterfolg der Großen Brachvögel im Königsauer Moos konstant zu halten und auch zu steigern, muss die Ursache der hohen Verlustrate von Jungvögeln analysiert werden. Eine hohe Prädation wird als mögliche Ursache für Jungvogelverluste diskutiert. Aber auch der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Invertebraten als Nahrung für Große Brachvögel wird dabei eine große Rolle beigemessen.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 16. Mai 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
52936 mal aufgerufen | 12

| 0

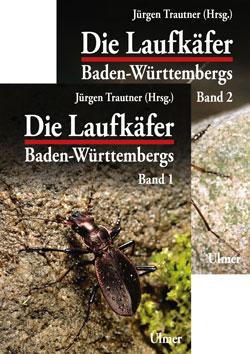
Titelbilder der zwei Bände des Buches „Die Laufkäfer Baden-Württembergs“.
(Bernhard Hoiß, Wolfram Adelmann) Im April 2017 erschien das zweibändige Nachschlagewerk „Die Laufkäfer Baden-Württembergs“ beim Ulmer-Verlag im Rahmen der Serie des Arten- und Biotopschutzprogrammes in Baden-Württemberg: Auf insgesamt 848 Seiten werden 429 Laufkäferarten – und somit drei Viertel aller in Deutschland vorkommenden Arten – detailliert behandelt. In einer erfreulich knappen aber präzisen Einleitung werden Datengrundlagen, die Biologie der Laufkäfer, deren Rolle in Ökosystemen und als Indikatoren sowie die Untersuchungsmethoden vorgestellt. Das Herzstück dieses Nachschlagewerkes bilden auf gut 600 Seiten die Artkapitel im speziellen Teil: hier werden die Verbreitung in Baden-Württemberg, inklusive Karten, Lebensweise und Habitat, sowie Gefährdung und Schutz der einzelnen Arten vorgestellt. Zu allen Arten gibt es gute Fotos, zudem sind die Lebensräume vieler Arten abgebildet. Interessant ist die Einordnung, ob die Arten zum charakteristischen Set der Lebensraumtypen nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gehören.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 11. Mai 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
50543 mal aufgerufen | 0

| 0


Titelseite des Artikels über Höhlenforschung.
Stefan Zaenker, Bärbel Vogel, Bernd Nerreter und Martin Harder
https://doi.org/10.63653/zvbp2186
Höhlen gehören zu den fragilsten Ökosystemen überhaupt. Durch die geringe Filterwirkung in Karstgebieten und hohe Durchflussraten des Oberflächenwassers gelangen Schadstoffe schnell und einfach in die unterirdischen Systeme. Während der Schutz von Höhlen als Geotop noch in den Kinderschuhen steckt, können beim Biotopschutz Erfolge vermeldet werden.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 25. April 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
51835 mal aufgerufen | 2

| 0


Titelseite des Artikels über die Siedlungsstruktur.
Franz Dollinger
https://doi.org/10.63653/kwri1276
In Deutschland ist eine Änderung des Baugesetzbuches beabsichtigt, welche im Rahmen der Bauleitplanung die Ausweisung von neuem Bauland durch eine Verfahrenserleichterung rascher und ohne Umweltprüfung ermöglichen soll (URL 1). Gleichzeitig beabsichtigt die Bayerische Staatsregierung im Rahmen einer Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms 2013 eine Lockerung des sogenannten Anschlussgebotes (URL 2).
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 21. April 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
50523 mal aufgerufen | 1

| 0

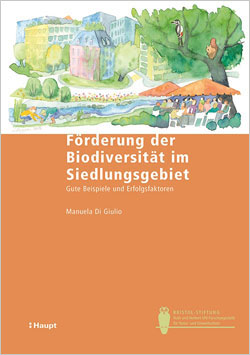
Titelbild des Buches „Förderung der Biodiversität im Siedlungsgebiet“.
(Johanna Schnellinger) Wie müssen Grünflächen in Siedlungsräumen gestaltet werden, um die Förderung der Biodiversität und die Bedürfnisse der Menschen in Einklang zu bringen? Das Buch stellt zwölf Best Practice-Beispiele in unterschiedlichen räumlichen Ebenen vor und definiert 26 Kriterien mit geeigneten Indikatoren zur Bewertung der Projekte. Diese Kriterien berücksichtigen die drei Aspekte der Nachhaltigkeit (Ökologie, Gesellschaft und Ökonomie) und wurden in Zusammenarbeit mit zahlreichen Akteuren, die ökologische und soziale Qualitäten von Grünräumen beeinflussen, ausgearbeitet. Die Best Practice-Beispiele müssen sowohl die ökologischen Anforderungen als auch die Bedürfnisse der Nutzenden erfüllen und zumindest zehn Kriterien erreichen.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 20. April 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
51316 mal aufgerufen | 0

| 0


Auch Grünstreifen in urbanisierten Räumen können Flächen hoher Biodiversität sein (Foto: Wilhelm Irsch/piclease).
(Leonie Freilinger) Gebäude schießen aus dem Boden, Straßen werden asphaltiert, Tiefgaragen gegraben – weltweit kann die fortschreitende Urbanisierung beobachtet werden. Laut Hochrechnungen der Vereinten Nationen werden bereits 2050 knapp 70 % der Weltbevölkerung in Städten leben (UN, 2008). Diese müssen naturgemäß weiter wachsen. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird Verstädterung häufig als eine der größten Gefahren für die Biodiversität angesehen. Die tatsächliche Tragweite ist jedoch noch wenig untersucht. So finden sich derzeit widersprüchliche Hypothesen über die Folgen der Urbanisierung für die Artenvielfalt.
Welche Faktoren urbane Biodiversität beeinflussen, wurde in einer Metaanalyse (BENINDE et al. 2015) untersucht, die die Daten von 87 Studien in 75 Städten weltweit zusammenfasste. Ziel war es herauszufinden, mit welchen Mitteln urbane Biodiversität gemessen und gefördert werden kann. Dabei ging hervor, dass die häufig angewandte Methode des Stadt-Umland-Gradienten zur Messung der Biodiversität nicht sehr sinnvoll erscheint. Hohe Biodiversität korreliert weniger mit der Entfernung zum Stadtkern als mit dem Vorkommen und der Größe von artenreichen Flächen, welche meist heterogen über das Stadtgebiet verteilt sind. Das können zum Beispiel Parkanlagen, Kleingärten, begrünte Dächer und Innenhöfe oder auch Brachen sein. Auf diesen Flächen wurden bis zu 50 % der in der gesamten Stadt vorkommenden Pflanzenarten gefunden (DYDERSKI et al. 2016).
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 19. April 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
52114 mal aufgerufen | 0

| 0


Titelbild des Buches „Ökosystemleistungen in der Stadt“.
(Johanna Schnellinger) Der dritte Bericht der Studie „Naturkapital Deutschland – TEEB DE“ thematisiert aus ökonomischer Perspektive die Zusammenhänge zwischen den vielfältigen Leistungen der Natur, der menschlichen Gesundheit und dem Wohlergehen in urbanen Räumen. Damit werden zusätzliche Argumente für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Natur sowie ihrer Ökosystemdienstleistungen entwickelt. Mithilfe vieler Best Practice-Beispiele in Info-Boxen werden Potenziale und Lösungsansätze vorgestellt.
Die Inwertsetzung der Natur wird in ihrer volkswirtschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen Bedeutung dargestellt. Ergebnisse der Identifikation, Erfassung und Bewertung von Ökosystemdienstleitungen können daher qualitative Auswirkungen (zum Beispiel regulierende Leistungen), quantitative Daten (zum Beispiel CO2-Bindung eines städtischen Waldes), sozial-ökologische Daten (zum Beispiel Energieeinsparungen durch Dachbegrünungen), Nutzenbewertungen (zum Beispiel Besucherzahlen) oder ökonomische Zahlungsbereitschaftsstudien sein.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 18. April 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
51917 mal aufgerufen | 0

| 0


Titelseite des Artikels über Innovationsgruppen.
Sebastian Rogga, Daniela Kempa, Nico Heitepriem und Florian Etterer
https://doi.org/10.63653/siso7388
Um Strategien gegen die negativen Folgen des Landschaftswandels zu erarbeiten, wird in jüngster Zeit verstärkt die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis gefördert. Ziel dieser disziplinenübergreifenden Forschungsverbünde ist nicht nur die Steigerung des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns, sondern zugleich die Erarbeitung konkreter Lösungsschritte für die beteiligten Praxispartner.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 13. April 2017
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
51405 mal aufgerufen | 0

| 0

Weitere Artikel:

 | 0
| 0