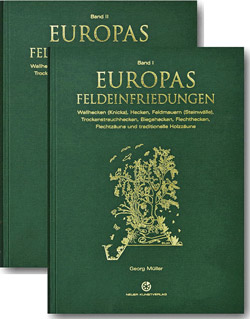Enzyklopädie der Hecken und Feldmauern Europas
(Andreas Zehm) Wer sich zukünftig vertieft mit Hecken, Feldmauern und anderen Begrenzungen von Feldern oder Weiden beschäftigen will, wird um das neue Grundlagenwerk „Europas Feldeinfriedungen“ nicht herumkommen. In einem extrem umfangreichen Werk ist das derzeitige Wissen zu allen Formen von Abgrenzungen in der Feldflur zusammengetragen und bestens illustriert aufbereitet. Dabei sind die insgesamt rund 6.000 Fotos und fast 1.000 Illustrationen prägendes Element der Darstellung. Enzyklopädisch werden in zwei schwergewichtigen Bänden europaweit die verschiedensten Einfriedungsmöglichkeiten – wie Wallhecken, Feldmauern, Hecken und andere Umzäunungen – kategorisiert, dokumentiert und umfangreich beschrieben. Allein „moderne“ Varianten, wie der kleinkarierte Maschendrahtzaun, sucht man zum Glück vergeblich.
Ziel beider Bände ist es, möglichst umfassend die noch in der Landschaft sichtbaren Dokumente einer uralten, menschlichen Kultur- und Landschaftsgeschichte zu erfassen und für die Nachwelt zu beschreiben. Absolut einmalig ist die Dokumentation der teilweise mehrere Jahrhunderte alten Relikte, egal ob es sich um Gehölzreste, Steinmauern, Erdwälle oder ganze Landschaften handelt. In mehr als dreißig Jahren Forschungstätigkeit und teilweise systematischer Bereisung der europäischen Großlandschaften hat der Autor einen einzigartigen Schatz zusammengetragen und populärwissenschaftlich aufbereitet. Teilweise erscheinen einem die Abgrenzungen etwas zu kleinteilig kategorisiert, aber nur so ist es möglich – wie in der Biologie – alle Ebenen vergleichbar der Systematik von der Familie über Gattung und Art bis hin zur lokalen Variabilität zu beschreiben und einzuordnen. Schade ist, dass sich durch die Aufteilung in übergreifende Kapitel und die zahlreichen Länderbeschreibungen zum einen Redundanzen ergeben und zum anderen sich auch mancher wertvolle Aspekt ausschließlich in einem Länderkapitel versteckt.