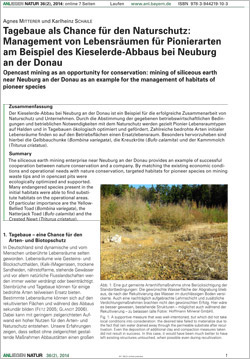Die Entwicklung der Übergangs- und Hochmoore im südbayerischen Voralpengebiet zwischen 1969 und 2013

In zahlreichen Mooren ist nach dem Ende von Entwässerungsbemühungen eine Rückentwicklung von Heiden zu Mooren zu beobachten. Beispielsweise im Ellbacher Filz im Ammer-Loisach Hügelland regeneriert sich bei 1.500 mm Jahresniederschlag in den flachen Mulden das Moor, während auf den durch die ehemalige Schlitzgrabenstruktur vorgegebenen Rippen noch Heidekomplexe zu finden sind (Foto: Giselher Kaule).
(Giselher Kaule) In den Jahren 1969 bis 1972 wurden die Hochmoore Süddeutschlands und der Vogesen inventarisiert, typisiert und naturschutzfachlich bewertet. 2010 bis 2013 erfolgte mit Unterstützung des Landesamts für Umwelt (LfU) eine Wiederholungskartierung der voralpinen und alpinen Moore Bayerns. Die Ergebnisse und Empfehlungen für die drei Naturraum-Hauptgruppen sind nun verfügbar (LfU 2015).
1974 veröffentlichte G. KAULE eine Untersuchung der Hochmoore Süddeutschlands und der Vogesen. 2010 bis 2013 konnten mit Unterstützung des Landesamts für Umwelt (LfU) die Moore des Bayerischen Voralpengebietes und die Alpenmoore erneut untersucht werden.
Die untersuchten knapp 45 Jahre Moorentwicklung sind ein ausreichender Zeitraum, um die Richtung der Sukzession von Pflanzengesellschaften sicher nachweisen zu können und kurzfristige Fluktuationen zu integrieren. Insgesamt wurden 350 Moore mit 2.500 abgegrenzten Flächen (Polygonen) in einem geografischen Informationssystem ausgewertet. Die Zusammenfassung der Ergebnisse und die Empfehlungen wurden nun als Umwelt Spezial-Heft vom LfU veröffentlicht. Die Ergebnisse werden in zahlreichen Karten und Tabellen dargestellt. Die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen für die übergeordneten Habitatgruppen werden im Folgenden zusammengefasst, Details können dem Bericht entnommen werden:
 | 0
| 0