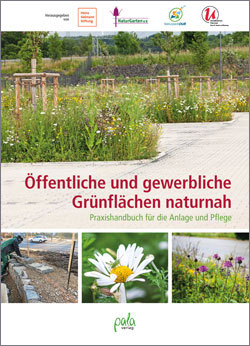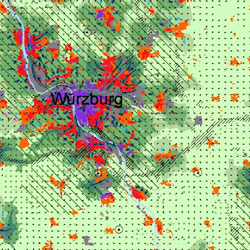Artenschutz in Planungs- und Zulassungsverfahren
(Paul-Bastian Nagel) Wir stellen in Anliegen Natur immer wieder aktuelle Urteile zum Artenschutzrecht im Zusammenhang mit Eingriffen vor. Dabei wird deutlich, wie dynamisch und komplex die Materie ist. Nicht selten bleibt es beim Mantra: es kommt auf den Einzelfall an. Mit seiner Dissertation „Artenschutz in Planungs- und Zulassungsverfahren“ bietet Andreas Lukas einen wertvollen Überblick über den rechtlichen Rahmen und entwickelt zu offenen Rechtsfragen Handlungsoptionen für die Praxis.
Trotz des (rechts-)wissenschaftlichen Anspruchs an eine Doktorarbeit, verknüpft Andreas Lukas die juristische Fachliteratur und Rechtsprechung gekonnt mit den naturschutzfachlichen Anliegen hinter den Rechtsvorschriften.
Durch die Auswertung von knapp 200 Artikeln aus rechtlichen, planerischen und ökologischen Fachzeitschriften, gelingt es dem Rechtsanwalt, die Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Die Steckbriefe in Anhang II zu den relevanten obergerichtlichen Urteilen zwischen 2017 und 2021 sind ein umfassendes Nachschlagewerk zur Artenschutz-Rechtsprechung.
Weiterlesen »

 | 0
| 0