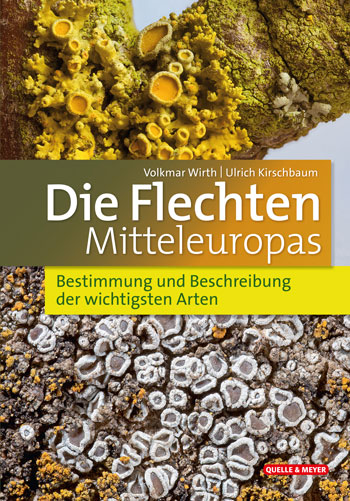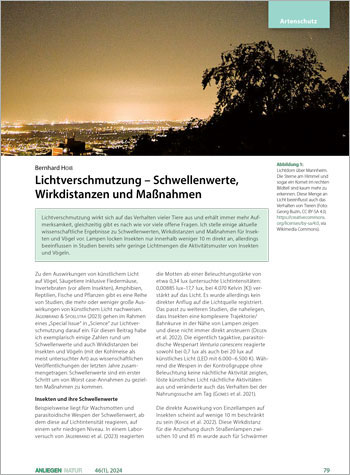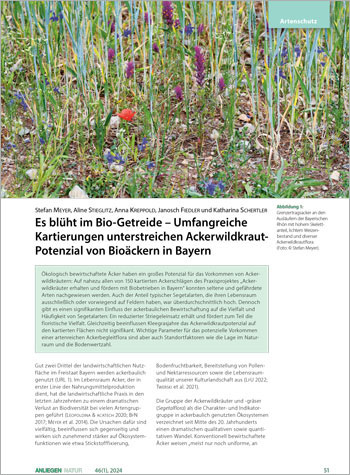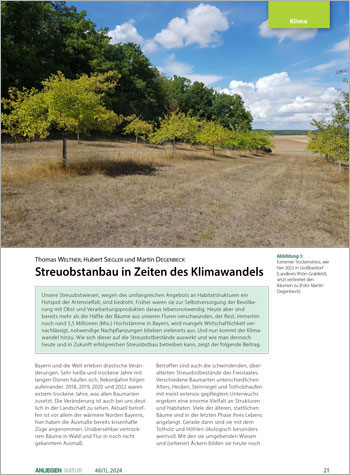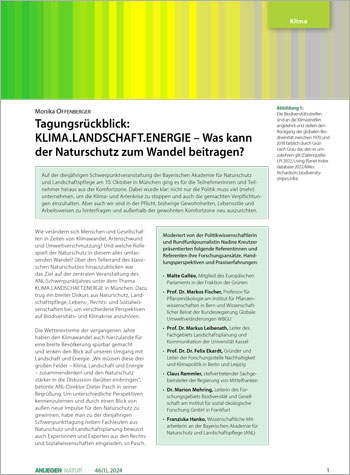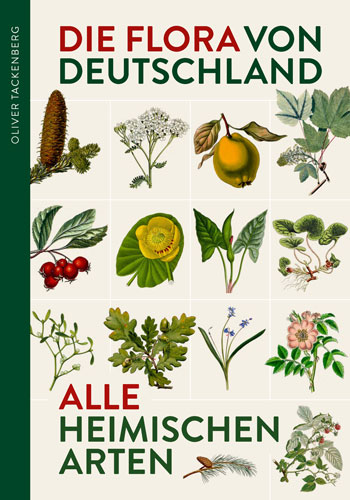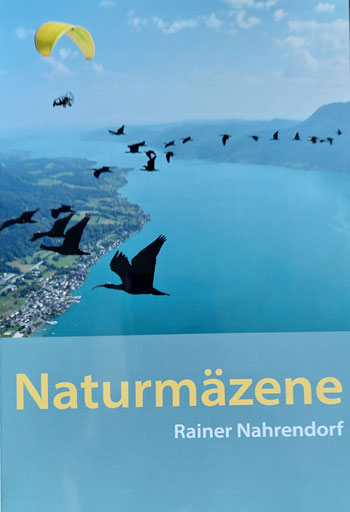Steigt das Waldbrandrisiko durch mehr Totholz im Wald?

Feuer im Wald ist bedrohlich und liefert gleichzeitig vielfältige seltene Strukturen. Mitentscheidend ist das Totholz, wie hier ein brennender Baumstumpf (Foto: Ylvers/Pixabay.com).
Verena Frey und Wolfram Adelmann
Steigt das Waldbrandrisiko durch mehr Totholz im Wald?
Die EU-Generaldirektion Umwelt (DG ENV) beauftragte LARJAVAARA et al. (2023) für eine Literaturstudie über das Waldbrandrisiko durch Totholz. Die Ergebnisse sollen als Leitfaden für gesetzliche Entscheidungen, für die Forstpolitik sowie für den Naturschutz dienen. Wir stellen Ihnen hier die Kernaussagen vor und diskutieren ihre naturschutzfachliche Relevanz.
Summary
Does more deadwood in forests increase the risk of forest fires?
The EU Directorate-General for Environment (DG ENV) commissioned LARJAVAARA et al. (2023) for a literature study on the risk of forest fires caused by dead wood. The results are supposed to serve as a guide for legal and political decisions, for forest policy and for nature conservation. In this article, we present the key messages and discuss their relevance for nature conservation.
Weiterlesen »
 | 0
| 0